|
|
| Staatsoper Wien |
12.09.2006 |
|

© Staatsoper GmbH / Axel Zeininger |
 |
Oper ist eine verrΟΦckte Sache
Ein Interview mit Leo Nucci in gedruckter Form wiederzugeben ist alles andere als leicht. Denn man sitzt keinem gewΟΕhnlichen GesprΟΛchspartner gegenΟΦber, der sich mit einem normalen Dialog begnΟΦgen wΟΦrde, sondern einem leidenschaftlichen Mann, der von einer unendlich groΟüen Liebe zur Musik beseelt ist, die ihn immer wieder so sehr mitreiΟüt, daΟü ihm Worte allein nicht genΟΦgen, um das, was er sagen mΟΕchte, auch auszudrΟΦcken. Immer wieder singt er einzelne Phrasen vor, wie diese seiner Meinung nach gestaltet werden mΟΦΟüten, um den Willen des Komponisten exakt wiederzugeben. Dazwischen ergreift er aber auch mal eine Serviette, um darauf eine Begleitfigur des Orchesters aus Verdis La traviata aufzuschreiben, die βÄ™ sofern sie ein Dirigent richtig ausfΟΦhren lΟΛΟüt βÄ™ eben nicht auf das so oft geschmΟΛhte Um-ta-ta hinauslΟΛuft, sondern Violettas bangen Herzschlag wiedergibt. Und einmal springt er sogar auf, um in der Kantine der Wiener Staatsoper vorzumachen, welcher Rhythmus sich ergibt, wenn vier MΟΛnner einen Sarg im gemessen Kondukt auf ihren Schultern tragen βÄ™ ein Rhythmus, der im letzten Bild der Traviata das Sterben Violettas einleitet. Auf solche ZusammenhΟΛnge in einer Partitur zu stoΟüen und sich ihrer bewuΟüt zu werden, lΟΕst bei Leo Nucci eine fast kindliche Begeisterung aus, die er auch versprΟΦht, wenn er im Interview davon erzΟΛhlt. Und wenn er im Laufe des GesprΟΛchs immer wieder beteuert, nicht der Karriere wegen wΟΦrde er singen, sondern weil ihn die Musik so sehr fasziniert, glaubt man ihm das aufs Wort βÄ™ ganz im Gegensatz zu etlichen seiner Kollegen, die sich mit ΟΛhnlichen Aussagen oft nur in ein gΟΦnstiges Licht stellen wollen.
βÄûSingenβÄ€, sagt Leo Nucci, der 1942 in Castiglione de Pepoli nahe Bologna geboren wurde, βÄûwar fΟΦr mich und meine Familie immer etwas ganz NatΟΦrliches. Es gab bei uns daheim niemanden, der nicht gesungen oder musiziert hΟΛtte. Ich erinnere mich noch gut an meine GroΟümutter. Von ihr habe ich zum ersten Mal viele der unsterblichen Melodien Verdis gehΟΕrt, die sie so gerne vor sich hingesungen hat. Auch ich habe frΟΦh zu singen begonnen, ohne dabei schon an eine professionelle SΟΛngerlaufbahn zu denken.βÄ€ Im Gegenteil, Leo Nucci erlernte zunΟΛchst den Beruf des Autoschlossers, den er acht Jahre lang ausΟΦbte. Heute noch mache es ihm riesigen SpaΟü, einen Motor zu reparieren oder andere handwerkliche TΟΛtigkeiten auszufΟΦhren und zeigt dafΟΦr als Beweis seine HΟΛnde vor, an denen sich noch frische Spuren manueller Anstrengungen finden. Trotzdem reizte es den jungen Autoschlosser, seine Stimme ausbilden zu lassen. Als im Jahr 1957 der GesangspΟΛdagoge Mario Bigazzi allwΟΕchentlich Nuccis Heimatdorf aufsuchte, um dort Stunden zu geben, nahm auch er bei ihm Unterricht. Von seinem Lehrer wurde er in der Ansicht bestΟΛrkt, er wΟΛre ein Tenor, ein Irrtum, den erst Maestro Marchesi aufklΟΛrte, ein GesangspΟΛdagoge in Bologna, zu dem ihn Mario Bigazzi eines Tages mitnahm. βÄûMarchesi sagte, ich sei ein Bariton, genauer, ein Bariton brillante, ein Fach, fΟΦr das ich aber noch zu jung wΟΛre. Daher riet er mir, erst in zwei Jahren wiederzukommenβÄ€ βÄ™ was Leo Nucci auch beherzigte. 1959 nahm er den Unterricht bei Maestro Marchesi auf, sechs Jahre spΟΛter erlaubte ihm sein Lehrer, erstmals an einem Wettbewerb teilzunehmen, den er prompt gewann, 1967 schlieΟülich debΟΦtierte Leo Nucci in Spoletto als Figaro in Rossinis Il barbieri di Siviglia.
Es war dies eine Zeit, in der das internationale Opernleben reich an erstklassigen Baritonen gewesen ist. Ettore Bastianini, Aldo Protti, Tito Gobbi, Giuseppe Taddei, Robert Merrill, der junge Piero Cappuccilli βÄ™ all das sind glanzvolle Namen, die im Pantheon der jΟΦngeren Operngeschichte einen festen Platz einnehmen. Leo Nucci aber ist heute nahezu allein auf weiter Flur, neben ihm gibt es kaum noch Vertreter seines Fachs, die auf vergleichbar hohem Niveau stimmliche SchΟΕnheit und perfekte Gesangskunst mit einem HΟΕchstmaΟü an interpretatorischer Intelligenz verbinden. Die Frage, warum es heutzutage so wenige erstklassige Baritone gibt, entlockt Leo Nucci zunΟΛchst einen tiefen Seufzer. Erst nach langem Ο€berlegen antwortet er: βÄûIch glaube nicht, daΟü es heutzutage weniger talentierte junge SΟΛnger und weniger schΟΕne Stimmen gibt als frΟΦher. Das Problem liegt anderswo. Kaum hat ein junger SΟΛnger erfolgreich debΟΦtiert, bekommt er bereits VertrΟΛge fΟΦr die nΟΛchsten zehn Jahre. Oft hat er zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht einmal seine stimmliche Ausbildung schon wirklich abgeschlossen. Das rΟΛcht sich, und nach zehn Jahren ist es mit der so hoffnungsvoll begonnenen Karriere wieder vorbei. Es fehlt das Fundament. Als ich bei Maestro Marchesi studierte, habe ich fΟΦnf Jahre lang nichts anderes als Vokalisen gesungen. Erst im sechsten Jahr meines Unterrichts habe ich mir einzelne Arien erarbeitet. Ich bin meinem Lehrer noch heute dankbar fΟΦr die harte Schule, in die er mich nahm und ich verehre ihn wie meinen GroΟüvater.βÄ€
Trotzdem war sich Leo Nucci, selbst nachdem er Wettbewerbe gewonnen und bereits als Solist aufgetreten war, noch immer nicht hundertprozentig sicher, ob er wirklich eine Sololaufbahn einschlagen sollte. Um Zeit zu gewinnen, aber auch, um weiter zu lernen, trat er daher in den Chor der MailΟΛnder Scala ein, dem er fΟΦnf Jahre lang angehΟΕrte. βÄûDas war fΟΦr mich eine sehr wichtige Periode. Ich habe viele wunderbare SΟΛnger aus unmittelbarer NΟΛhe hΟΕren kΟΕnnen und davon fΟΦr meine eigene Entwicklung stark profitiert.βÄ€ Nachdem er aber 1973 den Internationalen Viotti-Wettbewerb gewonnen hatte, versuchte er ein Comeback als Solist, wobei er neben dem Rossinischen Figaro auch schon seine andere Glanzrolle im Repertoire hatte, Verdis Rigoletto, den er mit dem GesangspΟΛdagogen Ottaviano Bizzarri erarbeiten konnte. Das Comeback verlief erfolgreich und 1977 kehrte Leo Nucci schlieΟülich auf die BΟΦhne der MailΟΛnder Scala zurΟΦck, nun aber nicht mehr im Chor, sondern als Solist. Erfolgreich debΟΦtiert er als Figaro, seit damals zΟΛhlt das Haus zu seinen zentralen WirkungsstΟΛtten. Der internationale Durchbruch gelang dem Bariton ein Jahr spΟΛter, als er an der Covent Garden Opera in London kurzfristig einen erkrankten Kollegen in Verdis Luisa Miller ersetzte. Schon im folgenden Jahr debΟΦtierte er als Figaro an der Wiener Staatsoper, 1980 in Verdis Un ballo in maschera an der Metropolitan Opera in New York βÄ™ eine glanzvolle Laufbahn nahm ihren Lauf...
Diese brachte Leo Nucci mit vielen bedeutenden Dirigenten in Kontakt. Wie er betont, wollte jeder von ihnen, der einmal mit ihm zusammengearbeitet hatte, wieder mit ihm musizieren. βÄûAuch Herbert von Karajan, unter dessen Leitung ich Un ballo in maschera fΟΦr CD aufgenommen hatte. Es sollten noch weitere Projekte folgen, doch sein Tod hat diese PlΟΛne leider vereitelt.βÄ€ Zu den PultgrΟΕΟüen, mit denen Leo Nucci gemeinsam auftrat, zΟΛhlen Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Carlo Maria Giulini, James Levine, Lorin Maazel, Zubin Mehta und Riccardo Muti. Eine ganz besonders enge kΟΦnstlerische Partnerschaft aber verband ihn mit Sir Georg Solti, der einmal, anlΟΛΟülich einer CD-PrΟΛsentation in London, einem kleinen Kreis von Journalisten anvertraute, besonders glΟΦcklich darΟΦber zu sein, daΟü ihn das Schicksal mit Leo Nucci zusammengefΟΦhrt hΟΛtte, den er als einen der bedeutendsten SΟΛnger der Gegenwart schΟΛtze und verehre. βÄûAuch fΟΦr mich zΟΛhlt die Begegnung mit diesem groΟüen Dirigenten zu den wunderbarsten FΟΦgungen meines LebensβÄ€, erklΟΛrt der Bariton. βÄûAls ich in Budapest sein Grab aufsuchte βÄ™ er wurde dort unmittelbar neben BΟ©la BartΟ≥k beigesetzt βÄ™ hat mich das sehr bewegt.βÄ€
Leo Nuccis Erfolg basiert nicht nur auf seinen auΟüergewΟΕhnlichen stimmlichen QualitΟΛten, es hat auch mit seinem groΟüen darstellerischen Talent zu tun. So brilliert er nicht nur in ernsten Rollen, etwa als verzweifelter Rigoletto, als ein in seiner Herrsucht hemmungslos alle Schranken ΟΦbersteigender Nabucco, als leidenschaftlicher Simon Boccangera oder als getriebener Macbeth, er kann auch ungemein komisch sein, etwa als Gianni Schicchi, mit dem er nicht zuletzt an der Wiener Staatsoper Triumphe feierte. Was auf der BΟΦhne jedoch so spontan und mitreiΟüend wirkt, ist bei ihm nie das Ergebnis eines unreflektierten Aus-dem Bauch-Heraus-Spielens, sondern Frucht einer grΟΦndlichen Vertiefung in eine Rolle. βÄûDen Figaro zum Beispiel nur als wirbelndes EnergiebΟΦndel auf die BΟΦhne zu stellen, wΟΛre zu wenigβÄ€, erklΟΛrt der Bariton. βÄûRossini wollte eine Art Figaro napoleone, also einen, der in den entscheidenden Momenten genau sagt, was zu tun ist.βÄ€ Und wieder lΟΛΟüt Leo Nucci der ErklΟΛrung sofort das Beispiel folgen, indem er jene Stelle vorsingt, in der Figaro dem Grafen Almaviva nicht einfach nur vorschlΟΛgt, sondern ihm geradezu vorschreibt, sich als Soldat verkleidet in Bartolos Haus einzuschleichen.
An der Wiener Staatsoper, an der Leo Nucci knapp 200 Mal aufgetreten ist, die ihn 1996 zum KammersΟΛnger und 2004 zum Ehrenmitglied ernannte, stellt sich der Bariton im September 2006 in einer neuen Partie vor. In der Wiederaufnahme von I vespri siciliani wird er erstmals in Wien den Guido di Monfort singen. Diese Oper Verdis hat es nie zu einer vergleichbaren PopularitΟΛt wie Aida,Rigoletto oder La traviata gebracht. βÄûIch kann das bis zu einem gewissen Grad verstehen, weil die Oper nicht von gleichbleibend hoher QualitΟΛt istβÄ€, meint Leo Nucci. βÄûAber manches darin zΟΛhlt zum Besten, was Verdi geschrieben hat. Schon allein die Sinfonia ist ein Meisterwerk. Sie ist nicht einfach ein verlΟΛngertes PrΟΛludium, sondern eine echte OuvertΟΦre.βÄ€
Verdi steht im Zentrum von Leo Nuccis Repertoire, dessen Musik er ganz besonders liebt. Trotzdem differenziert er, was die einzelnen Rollen anlangt: βÄûEin Posa ist wundervoll zu singen, keine Frage. Doch βÄΠβÄ€ und seine Stimme nimmt jenen bedeutungsvollen Klang an, mit dem er einer Aussage besonderen Nachdruck verleiht, βÄûβÄΠ ein Rigoletto oder Nabucco, ein Luna oder ein RenΟ© AnkarstrΟΕm, das ist nochmals eine andere Welt. Das sind Partien, die in ihrer Tessitura fast schon einem Tenor nahe kommen.βÄ€
Interessanterweise hat Leo Nucci, der brillante Barbier, so gut wie nie Mozart gesungen. βÄûDer Graf im Figaro oder der Guglielmo hΟΛtten mich schon gereizt. Dazu ist es aber leider nie gekommen und jetzt ist es dafΟΦr zu spΟΛt. In Konzerten singe ich aber manchmal die Arie des Figaro aus dem letzten Akt.βÄ€ Und wie ist sein VerhΟΛltnis zu Wagner? βÄûAls Melot in Tristan und Isolde bin ich einmal in Spoleto aufgetreten und in Konzerten greife ich manchmal auf Wolframs Lied an den Abendstern aus TannhΟΛuser zurΟΦck. Die romantischen Opern Wagners wΟΛren fΟΦr mich sicherlich kein Problem, da sie stilistisch in etwa dieselben Anforderungen an einen SΟΛnger stellen, wie die italienischen Belcanto-Opern. In seinen spΟΛteren Musikdramen jedoch geht Wagner auf eine ganz spezielle Art und Weise mit dem Text um, die sich mit meiner Art zu singen nur schwer vereinbaren lΟΛΟüt. Daher lasse ich davon die Finger.βÄ€
Rund 75 Mal steht Leo Nucci pro Saison auf einer OpernbΟΦhne oder auf einem Konzertpodium. βÄûVielleicht ist das mehr, als andere Kollegen tun, aber ich liebe das Singen. Es ist mein Leben und es gibt fΟΦr mich nichts SchΟΕneres, als vor dem Publikum zu stehen, um diesem mit den groΟüen Meisterwerken der Musik Freude zu bereiten.βÄ€ Diese Freude schΟΕpft Leo Nucci selbst aus der fortwΟΛhrenden BeschΟΛftigung mit den Partituren, wobei er immer wieder Neues entdeckt und sich dabei auch selbst weiterentwickelt. βÄûAm Beginn meiner Laufbahn wollte ich intellektuell alles selbst kontrollieren. SchieΟülich aber wurde mir klar, daΟü sehr viel auch von den Partnern auf der BΟΦhne abhΟΛngt. Auf sie muΟü man reagieren und es ist fΟΦr mich jedes Mal wieder ein besonderes GlΟΦcksgefΟΦhl, wenn sich dabei eine besondere Form der Interaktion einstellt.βÄ€ Das Augenmerk auf die Partner hat noch einen anderen Vorteil: Es beugt Routine vor, die unvereinbar ist mit jedem echten kΟΦnstlerischen Anspruch. Auch Leo Nucci sieht das so: βÄûRoutine wΟΦrde fΟΦr mich das Ende bedeuten. Das wΟΛre Erstarrung. Ich aber lebe, verΟΛndere mich mit jedem Tag, lerne stΟΛndig hinzu. Und all meine Erfahrung mΟΕchte ich ganz in den Dienst der groΟüen Komponisten stellen. Auf der BΟΦhne mΟΕchte ich nicht Leo Nucci sein, sondern die Figur, die mir an diesem Abend anvertraut wurde, sei dies nun Rigoletto, Macbeth oder irgendeine andere Partie.βÄ€ Und er ergΟΛnzt: βÄûOper ist eine verrΟΦckte Sache, zugleich aber auch sehr wahr, weil es in ihr um GefΟΦhle und Emotionen geht. Diese sind manchmal unberechenbar, deswegen sind sie aber um nichts weniger wirklich.βÄ€
Peter Blaha
Quelle: pro:log | Wiener Staatsoper, http://www.wiener-staatsoper.at |
|
 |
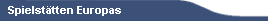 |
 |
|
| Liberec (Reichenberg), F. X. Šalda Theater |
|
| © F. X. ≈†alda Theater |
|

